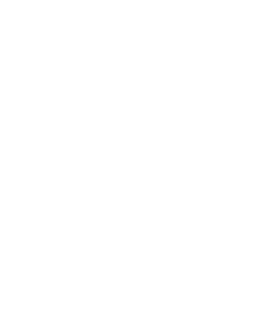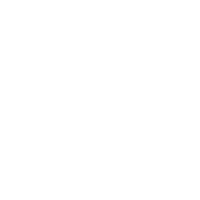Bin ich also atheistisch? Ein Atheist ist ein Mensch, der nicht an Gott glaubt; er erklärt die Entstehung und das Leben auf der Welt nicht mit einem Schöpfergott. Wenn man das kirchliche und religiöse Gottesbild zugrunde legt, bin ich ein überzeugter Atheist. Wenn man das hhhhh als Überwindung des allegorischen Gottesbildes annimmt, dann bin ich überzeugter Theist, oder besser: hhhhh–ist. Es gibt nicht Gott, aber es gibt hhhhh.
Warum betreibt der Mensch Naturwissenschaft? Warum ist der Mensch religiös? Auf beide Fragen kann man eine Antwort geben: Jeder Mensch ist darum bemüht, sich seiner Rolle in der Welt, die ihn umgibt, klar zu werden und sich darin zurechtzufinden. Dafür benötigt er gewisse unerschütterliche Gesetzmäßigkeiten. Ohne Wissenschaft, und endgültiger noch ohne Religion, wäre der Mensch verloren in der weiten, toten Welt seiner Existenz: Alles wäre sinnentleert. Böswillig könnte man ihm unterstellen, dass er den Grad von Intelligenz, den er besitzt, darauf verwendet, zu glauben, er sei ihm von Gott gegeben worden, damit er sich darüber hinwegtäuscht, dass er als einziges vernunftbegabtes Tier diese Probleme überhaupt hat. Anliegen von Wissenschaft wie von Religion ist die überlebenswichtige Frage eines Sinnes im Leben. Beide versuchen, eine universelle Antwort zu geben. Denn der Mensch hat Angst vor seinem Tod, weil er sich als Individuum für zu wichtig hält, als dass seine Existenz ausgelöscht werden könnte. Da ergreift ihn tiefe Verzweiflung, weil dann eigentlich sowieso alles egal wäre. Sowohl Religion als auch Wissenschaft versuchen die Zukunft und speziell den Tod aus dem Dunkel in einen Rahmen von Gesetzmäßigkeiten zu zwängen, damit auch er vorhersehbar wird und seinen Schrecken verliert. Mit diesen Gedanken im Hinterkopf kann man durchaus verstehen, dass die Gemüter sich erhitzen, wenn sich zwei Welterklärungsmodelle mit universellem Anspruch gegenüberstehen. Stelle dir vor, du seiest überzeugt, dass die Erde ein Würfel ist und hättest damit alle Fragen, die an dir nagen, gelöst, weil Gott nämlich gar nicht anders kann als im Innern dieses Würfels zu sitzen und alles auf Erden zu lenken – wie widerstrebend würdest du dich von angeblich viel richtigeren Erkenntnissen überzeugen lassen wollen, sie überhaupt nur anhören! Denn dann kehrt der ungeliebte Zweifel zurück. Aber woher rührt die Kluft zwischen Wissenschaft und Religion? Die Ungleichheit scheint ganz offensichtlich, grenzen sich doch beide Gruppen zumeist voneinander ab: Ein wissenschaftlich fragender Christ verfehlt den Kern seines Glaubens oder verliert ihn, ein Wissenschaftler, der auch nur Anleihen nimmt an spirituelle Vorstellungen und Erklärungsmodelle gleich welcher Religion, wird als Esoteriker abgetan (s. Rupert Sheldrake). Die scheinbare Unvereinbarkeit liegt in der verschiedenen Methode. Religion (hier = Judentum, in Bezug auf seine Entwicklung zur Staatsreligion auch das Christentum) ist Glauben ohne Grund. So sagt ein Wissenschaftler. Religion ist Glauben aus tiefer Überzeugung des Herzen. So sagt der Gläubige. Religion ist das Fürwahrhalten einer Welterklärung, die nicht objektivierbar ist, sondern sich am Menschen und seiner Rettung orientiert. Glauben ist das sich Erklären grundlegender Lebensfragen unter Berufung auf ein transzendentes Wesen, im Falle des Christentums eines Schöpfergottes, der außerhalb der Welt steht und deshalb allmächtig in seinem Handeln und Wirken ist. Dieser Gott ist einem Menschen sehr ähnlich, eine klar umrissene Person, die aktiv in Erscheinung und Aktion tritt. Ein religiöser Mensch schöpft große Kraft und Trost aus der Vorstellung eines uneingeschränkt liebenden Gottes und leitet seine Moral (auch) von religiösen Wertmaßstäben ab. Religion regelt das Verhältnis des Mensches sowohl zu sich selbst als auch zu seinen Mitmenschen. Wissenschaft hätte sich vor der Religion entwickelt, wenn erstens die Menschen, die die Religion kultiviert haben, nicht unter Herrschern, sondern frei gelebt hätten (Vatergott) und zweitens sie die technischen Möglichkeiten beispielsweise einer Materieanalyse gehabt hätten. Dann hätte die rationale Erklärung der Welt näher gelegen. Weil sich die bohrenden Existenzfragen aber nicht bis zum technischen Durchbruch aufschieben ließen, griffen die Menschen auf ihre Fantasie zurück. Die Folge: Ein sehr menschliches Gottesbild. Das ist auch nötig. Abgesehen vom vergleichsweise geringen Wissen der Alten über die Welt bot es sich nicht an, ein völlig abstraktes Gottesbild zu erfinden, erstens weil es nur wenige verstanden hätten, es seinen Tröstezweck damit verfehlt hätte und schnell wieder in der Versenkung verschwunden wäre (s. „Wasser als Urkraft“ von Thales) und zweitens weil es weder der Lebenswirklichkeit noch der Vernunft entsprochen hätte: Ein menschlicher Gott wirkt bekannt und damit plausibler als ein diffuser Geist (vgl. lokal begrenzte Ausbreitung des Buddhismus, der an einer anderen Lebenserfahrung ansetzt). Das oberste Prinzip der Religion ist also der Glaube, das Vertrauen und die Liebe. Wissenschaft ist ganz der Ratio verschrieben. Es geht um exakte Beobachtung der Natur, die im Falle beliebiger Wiederholbarkeit gedeutet und in einen übergeordneten Kontext gestellt werden, um größere und komplexe Systeme in ihrer Wirkungsart und –weise zu erklären. So werden Gesetzmäßigkeiten der Natur gefunden, die in der Beziehungssprache der Mathematik ausgedrückt werden. Die Deutung geschieht auf Basis alter, beglaubigter und eingeordneter Daten und Gesetze. Daher ist der Grundsatz der Wissenschaft der Beweis, ein Argument, das immer gern im Wortkampf gegen religiöse Kontrahenten vorgebracht wird. Das bedeutet grundsätzlich auch, dass mit dem Auftauchen von Gegenbeweisen Zweifel am gegenwärtigen wissenschaftlichen Weltbild und seiner Konsistenz regen. Erhellendes berichtet auch der Physiker Hans–Peter Dürr: Er habe nach dem zweiten Weltkrieg, der Herrschaft Hitlers und der anschließenden Bevormundung durch die Alliierten ein so tiefes Misstrauen gegen alles Menschliche gehegt, dass ihm die Physik wie eine Oase der objektiven Rationalität vorkam – hier konnte er Dinge erst dann für wahr halten, wenn er sie selbst unwiderlegbar bewiesen hatte, denn Wissenschaft ist ichlos, nur der Sache dienend, frei von persönlichen Befindlichkeiten. Fast ist die Wissenschaft nekrophil. Und keine Wissenschaft war das in der Vergangenheit mehr als die Physik: Um zu erkennen, „was die Welt im Innersten zusammenhält“, nahmen die Physiker die Welt immer weiter auseinander. Des Griechen Demokrits Atome als unbestimmte Ursubstanz des Seins wurden später mit entsprechenden Instrumenten gesucht und gefunden. Doch es stellte sich heraus, dass auch Atome eine Struktur besitzen, und so begann die endlose Forschung nach dem subatomaren Teilchen, das selbst keine innere Struktur besitzt. Vielleicht hofften die Wissenschaftler, Gott in ihm zu finden. Der Gedanke hinter der Aufgliederung der Materie war der, die Funktionsweise ihrer Teile zu verstehen und damit das Gesamtverhalten des Systems für jeden beliebigen Zeitpunkt voraussagen zu können. Auf Grundlage der Materie vollziehen sich Wechselwirkungen – ein Heilmittel gegen die Ungewissheit. Vielleicht steht am Ende der Analyse der Materie die Erkenntnis, dass es Gott nicht gibt und alles durch gesichtslose Gesetzmäßigkeiten erklärt werden kann. Aber auch das ist eine Gewissheit, an der man sein Handeln ausrichten kann. Die Methode der Wissenschaft ist die des Zerschneidens, des Sezierens, des Forschens nach der Funktionsweise der Dinge in ihren Einzelteilen. Wissenschaftler sind gesichtslose Diener der Wahr-heit. Wissenschaft ist ein Materialismus: am Greifbaren haftend. Bereits Max Planck, ausgerechnet der Begründer der wegweisenden Quantenphysik, hat die Lösung für diese ganz divergent daherkommenden Erklärungsmodelle der Welt vorformuliert: „Für den gläubigen Menschen steht Gott am Anfang, für den Wissenschaftler am Ende aller seiner Überlegungen. Es ist so, als gingen Wissenschaftler und Frommer auf ein Ziel, die Stadt der Erkennt-nis, zu: Beide kommen in der Stadt an, der eine aber hat eine Karte, die Windrichtung und den Stand der Sterne sowie ein Messgerät zur Bestimmung der optimalen Strecke zur Hilfe genommen, der andere hat sich auf seine Intuition verlassen. Wenn sich beide am Ziel wieder begegnen, kann dann einer den anderen für seine Methode, Erkenntnis zu erreichen, ablehnen, wo sie sich doch wieder gegenüberstehen? Vielmehr kommt es auf die Beschaffenheit des Ziels an, und das ist, wie Max Planck sagt, Gott. Mit der Entdeckung der Quantenphysik durch Max Planck trat ein Naturverständnis in die Welt, das außerordentlich befremdet, in Wahrheit aber schon uralt ist. Beweise für dieses neue Weltbild wurden im Verlaufe des letzten Jahrhunderts in den unterschiedlichsten Bereichen zusammengetragen: der Psychologie, Ökologie, Physik, Biologie, Soziologie usw. Dieses Weltbild existiert schon lange in den östlichen Philosophien. Wenn ich also gleich einen Abriss über die Quantenphysik gebe, werde ich sie mit Gott in Verbindung bringen und zeigen, dass einzig die Sprache einem gemeinsamen Weg im Weg steht. Einzig das personifizierte Gottesbild eines väterlichen Schöpfers lasse ich hinter mir. Warum es hinderlich ist, wird gleich klar. Am Ende steht also eine neue Gottesdefinition. Langsam erinnern sich Wissenschaft und Religion daran, dass sie unterschiedlich über das Gleiche reden. Die Voraussetzungen sind gleich: Wieder wird ein grundlegendes Wirkungsprinzip gesucht. Doch es ist grundlegend anders. Die Erkenntnis der „neuen“ Physik (H.P. Dürr) ist: Es gibt gar keine Materie. Die neue Physik führt damit zwei Dinge ad absurdum: Determinismus und Realität (= dinghafte Wirklichkeit). Es stellt sich heraus, dass weder Protonen noch Elektronen noch Photonen noch irgendeine andere Teilchensorte Teilchen sind. Die fraktalgeometrische Vorstellung eines Atoms, das wie ein Planetensystem aussieht, entstand aus Erklärungsnot: Wie sonst sollte man sich physikalische Phänomene wie die Leitfähigkeit von Stoffen einfach und anschaulich erklären als mit kleinen negativen Tennisbällen, die durch Drähte schießen. Das entspricht unserer makroskopischen Welt fester physikalischer Gesetze und voraussehbarer Reaktionen auf bestimmte Impulse. Vielmehr aber verschwimmt auf der mikrosko-pischen Ebene alles: sowohl die angeblich feste Materie als auch die Gesetze, denen sie folgt. Es gibt keine Atome, sodass man feststellen könnte: Da hinten ist es, und gleich dort drüben. Die Realität ist keine Realität mehr, sondern eine inkonstante, undeterminierte Potentialität: eine Welt unbegrenzter Möglichkeiten. Es gibt Erwartungsfelder, die mathematisch mögliche Formen der Realisation und Manifestation beinhalten. Aber keine dieser Manifestationen existiert wirklich: Sie könnte existieren, ähnlich wie ein Gedanke, der einem in den Kopf schießt, bevor er sich verbalisiert – mehr eine verschwommene, nicht fest umrissene Ahnung. Jedes Teilchen stellt ein solches Erwartungsfeld dar. Es ist ein fremder Gedanke, aber gemäß der Quantenphysik ist zuerst die reine, ganzheitliche Form, Sein ohne einen Träger. Aber die Software eines Computers existiert ja auch ohne Hardware. Man kann es sich grob vorstellen wie ein Gitter: Was die Welt wirklich im Innersten zusammenhält, sind nicht die Punkte, die durch Linien verbunden sind, sondern die Linien – Beziehungen also, aber ohne Dinge, die sich aufeinander beziehen. Da sich Quantenprozesse außerhalb von Raum und Zeit, die sie selbst erst entstehen lassen, abspielen, gibt es weder räumliche noch zeitliche Trennung – alles ist eins. Um diese Wirklichkeit auszudrücken, müsste man eine Sprache nur mit Verben sprechen, in der Bewegter und Beweger (s. unbewegter Beweger!), Anfang und Ende, Erlebnis und Erleber identisch sind – wie ein Ozean, auf dem Wellenkronen schäumen: Von weiter weg betrachtet wirken sie wie getrennte Berge, und schwimmen doch auf dem Ozean, aus dem sie kommen und verschmelzen beim Niedergehen erneut mit ihm: Nie wird man nach dem Eintauchen den Ort eines einzelnen Tropfens bestimmen können, weil sich die Frage in der Gesamtheit des Ozeans nach einem Tropfen gar nicht stellt. Der Ozean ist kein Sack aus Tropfen, sondern ein Ganzes. Es gibt kein Getrenntes, nur Erhebungen im Sein. Am ehesten trifft ein Wort die Essenz des Quantenseins: Liebe. Eine tiefe innere Verbundenheit, ohne dass gefragt werden muss, von wem die Liebe ausgeht. Es ist ein Zustand ewigen Seins, eine Wirklichkeit. Die Materie nun, die Manifestation der Potentialität ist ein Berührungspunkt der Linien aus dem Gitter von oben. Physikalisch gesprochen heißt das: Durch einen Eingriff in den Quantenprozess muss die Potentialität zerstört und eine der Möglichkeiten zur greifbaren Realität werden. Wie dieser Eingriff aussieht, hat Schrödinger mit seiner berühmten Katze anschaulich erklärt: Man sperrt eine Katze in eine blick– und auch sonst dichte Kiste, in der eine bestimmte Menge eines radioaktiven Elements mit einer Phiole verbunden ist. Mit einer nicht bestimm-baren Wahrscheinlichkeit zerfällt ein Atom dieses Elements innerhalb der nächsten halben Stunde – in diesem Fall wird die Phiole zerschlagen, eine giftige Flüssigkeit tritt aus und die Katze stirbt. Der Zerfall ist ein Quantenprozess, es gelten also keine deterministischen Regeln, sondern ein wertungsloser (aber nicht blinder!) Zufall. Nach dreißig Minuten ist der Versuch beendet und die Kiste wird geöffnet. Nun können zwei Fälle eingetreten sein: Entweder ist ein Atom zerfallen und die Katze ist tot, oder keines ist zerfallen und die Katze lebt. Beide Fälle sind gleich wahrscheinlich. Gewissermaßen überlagern sich in der noch verschlossenen Kiste jetzt zwei geisterhafte Katzen, die eine tot, die andere lebendig. Wer entscheidet nun, ob die Katze tot oder lebendig ist? Der Beobachter. Genauer: Das Bewusstsein, der Geist des Beobachters. Dieses ist mit dem Quanten-ganzen verbunden, geht eine Wechselwirkung mit ihm ein. Durch die Erwartung des Beobachters an das Experiment bzw. durch verschiedene Messtechniken, die von bestimmten Erfahrungen, die der Beobachter gemacht hat o.ä., beeinflusst werden, „rutscht“ eine der beiden wahrscheinlichen Katzen unter die andere und offenbart die jetzt nicht mehr potentielle, sondern reale Katze, entweder tot oder lebendig. Das bedeutet zweierlei: Erstens gibt es am Grunde des Seins keine Realität, nur eine Relativität, in der keine Gegensätze existieren, kein lebend oder tot, kein hier oder dort, kein fest oder flüssig, nur das Sein. Und zweitens ist das menschliche Bewusstsein unlösbar mit diesem Quanten-bewusstsein verbunden. Das ist schwierige Kost. Das ist aber gut so, denn hier liegt vielleicht der Schlüssel zum Verständnis unserer Existenz verborgen, und würde der uns einfach in die Hände fallen, was macht man dann mit dem Rest seines Lebens, wenn man sich nicht früh kreuzigen lässt. War das geschmacklos und blasphemisch? Nur wenn wir einen menschlichen, persönlichen Gott denken. Andernfalls ist der Konflikt zwischen Religion und Wissenschaft eigentlich neutralisiert. Ich postuliere ein neues Gottesbild, eines, das sowohl der Quantenphysiker gefunden als auch Jesus von Nazareth sowie Buddha samt aller Erleuchteten und Weisen hat. Ich postuliere Gott als das alles durchdringende Weltbewusstsein, das mit allen seinen Teilen identisch ist. Gott ist ein holistisches Bewusstsein. Das ist aber keine neue Erkenntnis – die Vorstellung der Schöpfung durch sich selbst und als sich selbst kann man sich als Kreis vorstellen und damit der langen Tradition in östlichen Philosophien vergleichbar. Die Biologie hat das Phänomen der morphischen Felder entdeckt. Obwohl nicht offiziell anerkannt, weil sie nicht ins reduktionistische Weltbild der vorherrschenden Wissenschaft passen, stellen sie nichts anderes dar als transzendentes, alles durchdringendes Feld, das Organismen zeitlos mit der Welt verbindet: Alles hängt zusammen. Die Ökologie kennt die Gaia–Hypothese, die besagt, dass die Erde ein einziger, riesiger Organismus ist: Alles hängt zusammen. Wissenschaftler wie Einstein glaubten nicht an einen persönlichen Gott, sondern an die wundervolle Natur als Gottheit. Dieses Modell nennt sich Pantheismus: Gott ist in allem. C.G Jung hat den Begriff des kollektiven Unbewussten geprägt und meinte damit einen über den Menschen stehendes Sammelbecken, in das jede Erfahrung jedes jemals existenten Einzelindividuums eingeht und von dem dieses unbewusst Gebrauch machen kann, sprich, dass die Menschen aller Zeiten auf eine nichtmaterielle Weise verbunden sind: Alle Menschen entfalten sich in Hinblick auf ein kollektives (Un)Bewusstsein. All diese Phänomene haben die gleiche Essenz, die schon Aristoteles vor über zweitausend Jahren auf den Punkt brachte: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Die alte Physik hätte da noch vehement widersprochen. Doch langsam vollzieht sich ein Sinneswandel dahingehend, dass man zu der Erkenntnis gelangt: Auf einer transzendenten, nichtmateriellen, traditionell wissenschaftlich nicht bestimmbaren Ebene ist alles durch ein übergeordnetes Bewusstsein verbunden. Wir nennen es vielleicht Seele als der Geist, der das Leben ausmacht. Wenn man einen Organismus auf seine Teile reduziert, kann man ihn nicht als Ganzes verstehen, weil diese Beseelung fehlt. Man muss aufs Ganze schauen. Dann entpuppen sich alle scheinbaren Widersprüche von Religion und Wissenschaft als nicht existent, als bloße Kommunikationsfehler. Der Mensch ist von seiner Natur als Tier aus nicht zu transzendentem, holistischem Denken geschaffen, sondern um des Überlebens willen an seine Umwelt angepasst. Das Instrument, sich die Welt dennoch zu erschließen, die Sprache nämlich, ist dazu aber denkbar ungeeignet, weil sie nämlich einen einschränkenden Charakter hat: Ich zerstöre sozusagen, um die Mängel der Sprache quantenphysikalisch zu begründen, die Potentialität und picke eine aus den unzähligen möglichen Realitäten heraus, indem ich die Welt um mich herum benenne. Deshalb ist die Möglichkeit der Sprache und damit die der Erkenntnis in den Grenzen, die sie sich selbst setzt, gefangen. Ich kann das Unsagbare nicht sagen, und erst die Sprache erschafft Unsagbares – wenn ich keine Lebensmittel habe, kann ich mir keine Lebensmittelvergiftung holen. Bei alltäglichen Begriffen ist das nicht bemerkbar, weil hier Einheitlichkeit der Wahrnehmung herrscht: Das Wort Apfel löst bei jedem, der des Deutschen mächtig ist, eine grundsätzlich ähnliche Assoziation aus. Nicht so der Begriff „Gott“: Dieses Lautsymbol füllt jeder mit einem individuellen Sinn. Daher ist dieses Wort als Mittler zweier Parteien, die sich über den „Gott“ austauschen wollen, nicht nützlich, sondern schafft Missverständnisse, die nicht ausgeräumt werden können, weil keine besseren Worte zur Verfügung stehen. Solange ein persönlicher Gott, dessen Abbild der Mensch ist, als Platzhalter, der er ist, verstanden wird, als Symbol, das seine Bedeutung nicht a priori enthält, werden keine solchen Missverständnisse entstehen. Personifiziert wird Gott der besseren Greifbarkeit wegen, weil man sich Liebe und Gnade ihrem menschlichen Verständnis entsprechend nur von Menschen ausgehend vorstellen kann. Das hat aber zur Folge, dass der Mensch menschliche Eigenschaften auf seinen Gott projiziert. Deshalb erscheint Gott als Abbild des Menschen und scheint verteidigt werden zu müssen, angreifbar zu sein, überhaupt ein getrenntes Individuum zu sein. Ein viel geeigneteres Mittel, um über „Gott“ zu sprechen, ist ein Medium, das Emotionen, die ihrer Natur gemäß präverbal und damit prärational sind, nötig (z.B. Musik!). Wenn Jesus von der Liebe Gottes spricht, verwendet er das Wort „Liebe“, mit dem ein Gefühl, kein Bild verknüpft ist, weil es am ehesten die innige Verbundenheit aller Dinge umfasst. Wenn Jesus sagt, er sei Gottes Sohn, so formuliert er noch milde, weil er natürlich um die Reaktion der anderen Menschen wusste: In Wahrheit ist er Gott. Und ich bin Gott. Und jeder, der jetzt liest, ist Gott, eben weil es kein Gott oder Mensch gibt. Es ist so: Gott ist das seiende Meer, die Menschen sind die Schaumkronen der Wellen, die sich als Individuen wahrnehmen, aber immer noch die Verbindung zum ganzen Sein haben. Indem aber dem Gottesbegriff ein personifizierendes Moment eingeprägt ist, konnte man Jesus nicht verstehen. Es ist deshalb ein nicht vorbelasteter Name für das nötig, was Gott eigentlich ist: Ein holistisches Bewusstsein. Das unvermischte Sein, das alles durchdringt, das alles verbindet, das alles ist. Der Ozean, auf dem Schaumkronen tanzen. „Gott“ ist. Es stellt sich nicht mehr die rationale Frage nach der Qualität der Verbundenheit, es zählt nur noch die Verbundenheit selbst. Er ist Liebe. Ich gebe diesem holistischen Sein einen Namen, der völlig abstrakt ist und deshalb diese beschriebenen Eigenschaften beinhalten kann: hhhhh. Für den Menschen heißt das: Er ist Gott, weil er hhhhh ist. Der Tod ist demnach kein Ende, sondern das Zurücksinken der Schaumkronen in den Ozean, die Ich–Entledigung und das Eingehen ins hhhhh. Und sonst gilt, um den damit erreichten Schulterschluss von Naturwissenschaft und Religion nicht erneut zu lösen, ein Satz von Ludwig Wittgenstein: „Worü-ber man nicht reden kann, darüber muss man schweigen.“ Bin ich also atheistisch? Ein Atheist ist ein Mensch, der nicht an Gott glaubt; er erklärt die Entstehung und das Leben auf der Welt nicht mit einem Schöpfergott. Wenn man das kirchliche und religiöse Gottesbild zugrunde legt, bin ich ein überzeugter Atheist. Wenn man das hhhhh als Überwindung des allegorischen Gottesbildes annimmt, dann bin ich überzeugter Theist, oder besser: hhhhh–ist. Es gibt nicht Gott, aber es gibt hhhhh.