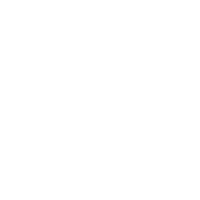Stellt euch vor, ihr müsstet im Unterricht ein dreidimensionales Objekt beschreiben: einen Würfel. Ihr werdet vielleicht darauf hinweisen, dass er von sechs Flächen mit gleichem Flächeninhalt begrenzt wird, dass daraus folgt, dass auch seine zwölf Kanten gleich lang sein müssen und zusammen acht Ecken bilden. Nun könnt ihr messen, wie lang die einzelnen Kanten sind, wie groß die Flächen, wie groß die Winkel zweier sich berührender Kanten, außerdem das Volumen des Würfels. Überdies werdet ihr auf eine mögliche Farbe des Würfels hinweisen. Die Mathematiker unter euch fassen ihre Beobachtungen vielleicht so zusammen: Die Kantenlänge a des blauen Würfels W beträgt je 4 cm, der Flächeninhalt einer Fläche ergibt sich aus AW = a2, das Würfelvolumen aus VW = a3, jeder Winkel beträgt 90°. Der Würfel ist berechenbar. Stellt euch nun vor, ihr müsstet ein weiteres Objekt beschreibend erfassen: einen Baum. Wo fangt ihr an? Ihr könntet zuerst sagen, ihr sähet ein Gebilde, das aus Stamm und Blätterkrone besteht. Den Stamm könntet ihr ausmessen. Doch bis wohin reicht er? Bis zu seinen ersten Verzweigungen, oder bis dorthin, wo, von außen betrachtet, das Blätterwerk beginnt? Außerdem könntet ihr die Dicke des Stammes bestimmen, zum Beispiel, indem ihr ihn zu umfassen versucht. Aber ist der Stamm auf jeder Höhe gleich dick? Einfach ist eines: Die Blätter sind immer grün. Außer natürlich im Herbst, da färben sie sich rot, orange, braun, einige bleiben grün, andere sind schon gefallen. Und ein Winterbaum: Ist der kein Baum mehr, weil ihm die Blätter fehlen? Ihr könntet eine mittlere Knospzeit ermitteln, aber wird sich der Baum jedes Jahr ihr entsprechend verhalten? Könntet ihr auf ein Gesamtkonzept des Baumes hinweisen? Ist ein Baum berechenbar? Gibt es „die Baumformel“? Es soll im Folgenden darum gehen, inwieweit Schule durch das ihr eigene soziale Netz bestimmt wird und welchen Nutzen ein Schüler davon trägt, der in dieses soziale Netz integriert ist. Die Einleitung soll dazu dienen, aufzuzeigen, um wie viel schwieriger es ist, auf diesem Gebiet in empirischer Beweisführung zu einem Ergebnis oder – noch besser – zu einer daraus abgeleiteten Aufforderung zu kommen, nun auf diese oder jene Weise handeln zu müssen. Denn wie man meinen ersten Artikel mit der Beschreibung des anorganischen Würfels gleichsetzen kann, so gleicht der zweite der Aufgabe, einen Baum in seiner Gesamtheit erfassen zu wollen. Der so von mir betitelte Bildungsaspekt der Schule stellt sozusagen das Mark des Baumes und gewissermaßen seine hautsächliche Existenzberechtigung dar, doch es würde formlos auseinander fließen, wenn nicht von einem stützenden und ebenso notwendigen Rahmen in die richtigen Bahnen gelenkt, den im System Schule das soziale Beziehungsgeflecht bildet, das in seiner Komplexität beschaffen ist wie die Krone des Baumes. Daher kann ich wieder keinen Anspruch auf die Vollständigkeit oder Richtigkeit meiner angeführten Gedanken erheben und möchte auch viel lieber Widerspruch bei meinen Lesern hervorrufen, um damit meiner im ersten Artikel erarbeiteten These zu entsprechen: Jeden Schüler zu einem kritisch hinterfragenden, eigenständig denkenden und handelnden Menschen mit einer unabhängig gebildeten Meinung zu machen, kurz: Ihm zu ermöglichen, ein individueller Mensch zu sein. Das Individuum in einer Gemeinschaft. Muss sich diese Forderung nicht als zu kurz gegriffen erweisen, wenn ich gleichzeitig behaupte, dass jeder Schüler in ein soziales Netz integriert ist? Wirkt nicht Gruppenbildung der Individuenbildung entgegen? Diese Frage soll der Rahmen meines zweiten Artikels über den sozialen Aspekt der Schule sein. Konflikte schaden Wir stehen in ständigem Kontakt zu unseren Mitmenschen. Für einen Schüler bedeutet das vor allem drei ihn bestimmende soziale Umfelder: das häusliche, das schulische und das der Freunde. Dass der Mensch sich überhaupt lieber erst einen Platz in der Gemeinschaft sucht als sich von ihr loszusagen, liegt einerseits an seinem Bestreben, in größtmöglicher Harmonie mit seinem Umfeld zu leben, weil alles andere ständigen Kampf bedeuten würde, und andererseits an der Kalkulation praktischen Nutzens. (Das Mammut im Rudel zu erlegen, ist effektiver als es allein zu versuchen …) Deshalb empfinden wir die Gemeinschaft als wohltuend und deshalb ist das Zusammenleben ein fest verankerter Bestandteil in unserem Individualleben. Wohin es dagegen führt, das Individuum zu entwerten und an seine Stelle die gesichtslose Masse zu setzen, hat man im „Dritten Reich“ beobachten können. Hitler selbst als teuflischer Demagoge wusste sehr genau, dass jeder kritische Protest eines einzelnen oder einiger weniger gebrochen werden kann durch die Dynamik der großen Masse. Natürlich entspricht ein Leitbild, an dem der einzelne sein Handeln ausrichten kann, viel eher dem Bedürfnis des Menschen als zahllose Wege und eine freie Wahl. Denn Entscheidungen getroffen vorgesetzt zu bekommen, untergräbt zwar den kritischen Geist des Einzelnen und macht ihn unfrei, scheint aber viel Ärger, den Verantwortung nach sich zieht, zu ersparen. Doch von der Kurzsichtigkeit und Verantwortungslosigkeit dieser Rechnung zeugt die Geschichte selbst. Und wer meint, dass dies nicht schon für die Schule gelte, lese Morton Rhues „Welle“. Man sieht also, es ist unbedingt notwendig, dass sich der einzelne seiner Individualität bewusst ist und diesem Wissen entsprechend freie Entscheidungen treffen und Verantwortung für sich selbst und andere übernehmen kann. Das Individuum muss den unbedingten Vorrang vor der Gruppe haben. Insofern findet sich hier auch mein Leitsatz des letzten Artikels (s.o.) bestätigt. Ein Agieren als Gruppe scheint zwar naturgegeben, aber es sieht so aus, als ob dies zwangsläufig das kritische Individuum schlucke und seine Kraft absorbiere. Schauen wir auf die Schule. Innerhalb des schulischen Umfeldes gibt es – grob gesprochen – drei soziale Untereinheiten: die so genannte Schulfamilie oder Schulgemeinschaft, die Klassengemein-schaft und die Interaktion zweier oder weniger Individuen, z.B. Freunde. Sie unterscheiden sich offensichtlich darin, dass der Umfang der sozialen Gefüge immer geringer wird. Immer tritt das Individuum in Kontakt mit anderen Individuen und eine Interaktion besteht. Diese Interaktion stellt soziale Gefüge her. Sie sind geprägt vor allem durch starke Gefühle, wie sie Jugendlichen zueigen sind, und dem Drang, sich selbst zu profilieren. Denn unabhängig davon, wie viele Individuen miteinander interagieren, versucht jedes, seine Individualität zu wahren, also die Gruppe möglichst stark an sich selbst anzupassen. Da das aber alle Individuen wollen, führt jede soziale Interaktion zu Konflikten, wobei die Freiheit des Individuums beschnitten wird. Das gilt in großem und genauso in kleinem Rahmen. Es macht auf die Dauer nicht glücklich, sich mit so vielen ja immer noch recht fremden Menschen (Stichwort: Klasse als Zwanggemeinschaft) sechs oder mehr Jahre lang herumschlagen zu müssen. Eine Bedingung aber ist für das erfüllte Dasein des Individuums, dass es glücklich ist. Damit ist die Ausgangsfrage geklärt: Tatsächlich ist die Maxime meines ersten Artikel utopisch, da die Freiheit und Selbstbestimmtheit, die der Bildungsaspekt verschafft, gewissermaßen von den Mitschülern wieder entwendet wird. Und doch hat auch der Konflikt in der Schule seine Existenzberechtigung. Das ganze ist gewissermaßen ein per aspera ad astra–Prinzip – durch die Dunkelheit zu den Sternen. Konflikte nutzen Bevor ich zum Nutzen der Konflikte komme, noch folgende Anmerkung, die zeigen soll, dass auch der Bildungsaspekt der Schule nicht fehlerlos ist: Was bedeutet es anderes für einen Schüler, in die Schule zu gehen, als zu lernen. Fürs Freunde Treffen bleibt keine Zeit mehr; es geht im Lernen, Hausaufgaben– und Sorgenmachen unter. Das ist Schule. Im richtigen Moment das Passende antworten, am besten mündlich und schriftlich auf gleichem Niveau, aber wehe, dieses Niveau entspricht nicht dem vorgesehenen: Dann hat man als Mensch versagt und sollte sich einmal Gedanken machen, ob die Schulform Gymnasium wirklich die richtige ist, denn dort kann nur die Elite unterrichtet werden. Etwa zu scheitern ist, obwohl man aus Misserfolg viel mehr lernen kann als von ständigem Erfolg, ein nicht überlebensfähiges Modell und im gegenwärtigen System nicht mehr vorgesehen. Gefordert ist gewissermaßen der Fünfmetersprung zum Abitur aus dem Stand. Schule erhält mit einem Mal eine ungeheure Wichtigkeit, wenn man es in die fünfte Klasse geschafft hat. Vorher noch verspielt, bekommen die jungen Menschen eine volle Breitseite „Leben“ um die Ohren gepfeffert. Die beiden Dinge, die sich am tiefsten eingegraben haben, wenn man aus der Schule kommt, sind, dass sich der eigene menschliche Wert vor allem über Leistung definiert und dass man nur brav das Maul aufmachen muss, um am Ende versorgt, aber regungsunfähig zu sein. In diesem Sinne muss ich vor einer Überschätzung des rein intellektuell orientierten Lernens warnen. Das „unnatürlich Gewachsene“ am Baum Schule ist das System, mit dessen Hilfe versucht wird, Schüler intellektuell zu bilden. Soziale Kontakte und Erfahrungen sind bloß ein Randaspekt, werden einfach hingenommen, als Nebenwirkung toleriert. Man kann dieses Soziale (ich wiederhole mich) in kein Schema zwingen und daher ist es statistisch und wirtschaftlich ein unerheblicher Randaspekt. Aber wie falsch, gibt es doch auch das soziale Lernen. Die Integriertheit in eine Gruppe verschafft dem Individuum ein Gefühl von Sicherheit. Ich kann natürlich keine Aufforderung formulieren, alle Abneigungen hinter sich zu lassen und mit jedem Freundschaft zu schließen. Das ist nicht möglich und auch nicht wünschenswert, wie wir gleich noch sehen werden. Als alleinige Voraussetzung ist Respekt, den Schüler ihren Mitschülern entgegenbringen, für ein soziales Miteinander, von dem die beteiligten Schüler profitieren, unentbehrlich. Respekt heißt, die Andersheit des Gegenübers anzuerkennen und sie zu tolerieren. Das zwanghafte Teilen von Meinungen oder Interessen ist damit nicht gemeint. Aber ein respektvoller Umgang schließt Mobbing aus, denn indem ich mein Gegenüber durch Respekt als Mensch anerkenne, verpflichte ich mich dazu, seine individuelle Freiheit und Einzigartigkeit zu schützen, und nicht anzugreifen. Also muss das Individuum zwangsläufig, um anerkannt zu sein, selbst anerkennen und umgekehrt. Praktisch kann eine Maßnahme sein, Schülern einen respektvollen Umgang nahe zu bringen, eine Klassenfahrt sein, auf der individuelle Fähigkeiten zutage treten können, die von der Schule nicht bedient werden. Unter diesen Bedingungen ist ein starkes soziales Gefüge gewachsen, das am Individuum eine Schutzfunktion ausübt. Damit es aber dem Individuum so vorkommt, muss noch eine weitere Bedingung erfüllt sein: gegenseitiges Vertrauen. Damit meine ich nicht die Gewissheit, die man durch Übungen erlangt, dass etwa Schüler A den sich fallen lassenden Schüler B am Rücken auffängt, sondern die Gewissheit, dass auch hinter dem Rücken von Schüler B Schüler A nicht über ihn lästert, egal ob Schüler B es bemerkt oder nicht. Denn noch schlimmer als die Gewissheit, verspottet zu werden, ist das beklemmende Gefühl, morgens einen Klassenraum mit Schülern betreten zu müssen, von denen man nicht weiß, ob sie nicht eben noch abfällig über einen gesprochen haben. So etwas gilt es zu unterbinden, vor allem von den Lehrkräften, denn es ist Schülern zwar zuzutrauen, bei Mobbing einzugreifen, doch nicht unbedingt zuzumuten, denn dabei gehen sie die Gefahr ein, selbst zum Opfer zu werden. Vertrauen kann auf zwei Weisen hergestellt werden: Einmal, indem von außen, also vom Lehrer Themen wie Mobbing offen besprochen und moralisch gewertet werden; die andere Möglichkeit ist, dass die Lehrer den Schülern vermitteln, ihnen zu vertrauen und ihnen damit auch ihren Respekt bekunden. Lehrer übernehmen also die Funktion von Vorbildern. Doch um ein glaubhaftes Vorbild sein zu können, muss sich jeder Lehrer ebenso als Teil des Lernprozesses verstehen und ihn als gemeinsames Anliegen mit den Schülern betrachten. Wenn man selbst ernst genommen wird, kann man selbst auch andere für voll nehmen. Also erwächst aus gegenseitigem Respekt Vertrauen. Leider neigen Schüler dazu, das in sie gesetzte Vertrauen zu missbrauchen. Der niederländische ehemalige Waldorfpädagoge Wim Veltman berichtet davon, dass gerade an Waldorfschulen, die ein offeneres soziales Konzept pflegt als staatliche Schulen, ein starker Hang der Schüler zur Asozialität zu beobachten sei. Das ist meiner Meinung nach vor allem deshalb bedenklich, weil es sich bei den Waldorfeinrichtungen um Privatschulen handelt, die somit eine viel geringere Schüleranzahl bedienen als öffentliche Gymnasien. An solchen sind asoziale Trends sicher nicht verwunderlich, zumal die soziale Bildung dort nur sporadisch stattfindet; auf Schulen hingegen, die einen sozialen Schwerpunkt gesetzt haben, mutet asoziales Verhalten schon seltsam an. Dieses ist aber vor allem altersbedingt. Insofern halte ich auch bei aller Entwicklungsfreiheit, die man Kindern und Jugendlichen in ihrem sozialen Lernprozess lassen sollte, Verhaltensregeln und auch Sanktionen für unentbehrlich. Hier muss der Lehrer (übrigens jeder Lehrer) als Autoritätsperson fungieren und die Schüler sozusagen dazu zwingen, Konflikte mit fairen Mitteln auszutragen. Respekt ist leider nur wenigen Menschen angeboren. Dagegen weiß ich kein Mittel, als seine Betroffenheit ehrlich zu zeigen. Mit Respekt und Vertrauen kann eine Gruppe, also z.B. eine Klasse gestärkt werden, denn diese beiden Tugenden sind Grundvoraussetzung für das Entstehen eines intakten Sozialgefüges. Voraussetzung beim Individuum hierfür ist auch eine große Eigenverantwortung, die das Individuum kritisch über sein Handeln reflektieren lässt und dem Gruppenzwang entgegenwirken kann. Natürlich ist es nicht möglich, dem anderen immer respektvoll zu begegnen und ein stabiles Vertrauens-verhältnis zwischen dreißig Schülern herzustellen. Hierbei spielt auch das Alter eine Rolle, denn je älter eine Klasse, umso reifer ist sie auch und umso eigenverantwortlicher. Ich würde sogar behaupten, dass man ohne einen gewissen Grad an sporadisch auftauchender Asozialität keinen Sinn für soziales Verhalten entwickeln kann. Ein erster Schritt dorthin ist z.B., Lästern so zu praktizieren, dass es den offenen Umgang mit dem „Opfer“ nicht eintrübt. Denn Lästern hat natürlich auch eine befreiende Wirkung. Wenn nun aber diese Tugenden, teils durch Lehrer, teils durch Mitschüler anerzogen, dem Möglichen entsprechend verwirklicht werden, hat das auch direkte Auswirkung auf den Bildungs-aspekt. Wenn nämlich ein Schüler z.B. keine Angst mehr haben muss, strebsam, gern für sich, immer gut gelaunt oder scheinbar komplexbeladen zu sein, verbessert das das Lernklima und beeinflusst Lernbereitschaft und Noten positiv. Zugleich kann jeder von den Kompetenzen anderer in einem bestimmten Fach profitieren und nicht nur neidisch die besseren Noten anderer Schüler begeifern. Das lehrt auch den helfenden Schüler, dabei nicht arrogant zu werden. Erst durch diese gegenseitige Inanspruchnahme bemerkt man auch das eigene Können und fühlt sich als Mensch bestärkt, zugleich noch akzeptiert. Ein harmonisches soziales Umfeld ermöglicht erst ein erfolgreiches Lernen. Umgekehrt kann man sich bei unerwünschten Noten auf mitfühlende Leidensgenossen verlassen, die schlechte schulische Leistungen relativieren. So bemerkt das Individuum etwas Entscheidendes: dass es nicht durch Noten ausgemacht wird. Weiterhin prägen den Schulalltag natürlich besagte Konflikte. Was kann man nun daraus lernen? Die Konflikte entstehen vor allem, weil eine Klasse eine Zwangsgemeinschaft ist: Das Individuum kann sich sein soziales Umfeld nicht aussuchen, und die Wahrscheinlichkeit ist groß, mindestens fünf anderen Schülern bzw. Schülerinnen nicht riechen zu können. Gleichzeitig garantiert aber eine Zwanggemeinschaft das Zusammentreffen völlig unterschiedlicher Charaktere mit völlig unterschiedli-chen Ansichten, Vorstellungen, Vorlieben, Abneigungen und Verhaltensweisen. Die Kunst ist nun, sich mit mög-lichst vielen davon über sechs Jahre hinweg so zu arrangieren, dass sich optimalerweise das oben beschriebene soziale Umfeld ausformen kann. Das klappt unterschiedlich gut und in Phasen, die ebenfalls altersabhängig sind (vgl. z.B. Liebe), weil die Integration des Individuums in eine Gruppe ein Lernprozess in zweierlei Hinsicht ist. Erstens erlernt man „by doing“ den Gebrauch der Werkzeuge, die nötig sind, um Respekt und Vertrauen zu entwickeln, also (in pädagogischem Jargon) soziale Kompetenzen. Zugleich aber betrachte ich den Lernprozess als individuelle Charakterfindung. Da-durch, dass man sich ständig mit Menschen in Kontakt und Auseinandersetzung befindet, die die eigenen Ansichten, Gedanken und Vorstellungen nicht teilen, anfechten, oder aber auch unterstützen, werden die Ansichten usw., die das Individuum ausmachen, auf die Probe gestellt. Das kann den Standpunkt des Individuums festigen, aber auch ins Wanken bringen. In jedem Fall ist in einer Klasse die Chance groß, den eigenen Erfahrungshorizont zu erweitern und zu einer eigenen, geprüften, dann wieder individuellen Weltsicht zu kommen (Eklektizismus), denn wir alle spielen im Umfeld Schule ein Rolle, die nicht unserem unvermischten Charakter entspricht. Diese Rolle ist wandelbar. In diesem Sinne: Erfindet euch immer wieder neu! Das kann man auch auf den intellektuellen Lernprozess anwenden, z.B. auf eine Gedichts-interpretation: Zu zweit oder in einer Gruppe kommen viel mehr Ideen zu einer möglichen Deutung zusammen als wenn man die Aufgabe allein löst. Das bedeutet ja nicht unbedingt, dass das Ergebnis eines einzelnen schlechter ist als das der Gruppe, doch deren Resultat ist zweifellos vielschichtiger. Wenn man sich als Schüler auch in einen derartigen Lernprozess involviert versteht (allerdings nur dann neidlos!), kann man zugleich Aussagen von Mitschülern besser würdigen, weil sie eine Idee hatten, die einem selbst nicht eingefallen wäre. Das führt wieder zum gegenseitigen Respekt. Außerdem lernt man mit der Zeit, seine eigene Meinung überzeugt und überzeugend anderen gegenüber zu verfechten und lernt kennen, wie andere es tun. Kurz: Man definiert sich selbst über Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu anderen. Zuletzt muss man zugeben, dass es einen stolz, zufrieden, glücklich oder wie auch immer stimmt, wenn man eine gerechte Konfliktlösung – vielleicht sogar ohne Hilfe von außen – geschafft hat. Und dieses Gefühl stärkt sowohl die Gruppe als auch das Selbstvertrauen des Individuums. Insofern ist an dieser Stelle ein Umdenken des Begriffes „Konflikt“ angebracht: „Konflikt“ bedeutet unter Betrachtung sozialer Gesichtspunkte nicht etwa „Streit“, sondern das sich Auseinandersetzen mit anderen, sich unterscheidenden Individuen auf Basis von (Eigen)Verantwortung, gegenseitigem Respekt und Vertrauen. Jetzt wird erkennbar, dass meine These aus Artikel eins doch ihre Richtigkeit hat: Sämtliche soziale Prozesse, namentlich vor allem der immer währende Konflikt, haben sich nun eindeutig der Charakterbildung förderlich zu erkennen gegeben, da erst durch den Kontakt und die Auseinander-setzung mit anderen das Individuum sich seiner Individualität bewusst wird und mit der Zeit zur Eigen-verantwortung und Fremdverantwortung heranwächst. Auch das kann ein Sinn von Schule sein. Appell zum Schluss Eine wichtige Grundvoraussetzung ist bisher aber unerwähnt geblieben: die Bereitschaft des Individuums, sich auf dieses „soziale Experiment“ einzulassen und den Willen zu zeigen, von der Gruppe mitbestimmt zu werden und gleichzeitig die Gruppe aktiv mitzubestimmen. Mitschwimmer, die sich nur ziellos treiben lassen und scheinbar gleichgültig jeder Auseinandersetzung gegenüberstehen oder sich der Konfrontation sogar beständig entziehen, haben nicht erkannt, dass ihre Verantwortung der Gruppe gegenüber auch darin besteht, sich einbringen zu wollen. Wie der einzelne das macht, ist individuell. Insofern ist dieser Artikel zu verstehen als Appell gegen die Gleichgültigkeit. Eine Anregung und Aufforderung dazu, den Mut zu haben, sich der zu Gebote stehenden Möglichkeit zu bedienen, sich selbst zu erkennen.
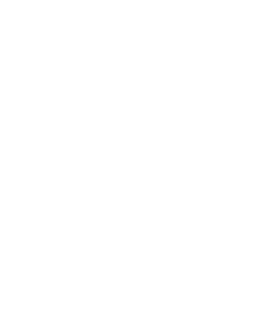
KAVG
Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium